 |
|
 Dorothea Ewers und Friedrich Hartz 1924 |
|
|
|
|
|
|
|
Auf dieser Seite :
|
|
|
|
|
Hartz im Kirchenbuch von Oldesloe |
|
Der Name
: "Der Name Hartig, auch
Hartigs, frühere Schreibweise Hartiges,
(heute Hartz), ist im Osten des Amtes verbreitet. Er
ist schon im Dienstgeldregister des Bischofs von Lübeck
in Schlamersdorf, Kirchkreis Oldesloe, nachzuweisen. In
diesem Dorf ist er auch noch vor 1565 vorhanden. 1526 wird
er in Dreggers und Weede im Kirchkreis Segeberg genannt,
seit 1526 in Stipsdorf (noch 1560), 1604 bis 1607 in Krems
I, Kirchkreis Leezen, seit 1628 in Schmalensee, Kirchkreis
Bornhöved, und von 1629 bis 1657 in Geschendorf,
Kirchkreis Pronsdorf." Nach Hans Bahlow: "Deutsches
Namenslexikon" beruht der Name Hartz (soweit es sich
um den Norddeutschen Namen handelt) auf einer falschen
Verhochdeutschung (um 1600) von Hartig / Hartich / Hartke /
Hartwig entweder von einer Anlehnung an "Herzog" oder aber,
was hier wahrscheinlich ist, von einer Anlehnung an Hartwig
= "kühn im Kampfe". |
|
Der Ort :
Der Boden ist teils schwerer Lehm, teils grandig und daher
für die Landwirtschaft nicht so günstig,
Hölzungen und Moor waren für den Bedarf
ausreichend. |
|
Die Leibeigenschaft in Schlamersdorf : Schon in Überlieferungen aus dem 11. und 12
Jahrhundert wird deutlich, dass es neben den freien Bauern
und reicheren Vornehmen in den Dörfern sogenannte
Schutz- und Pachtbauern (Colonen) gibt. Diese entstanden
immer dann, wenn der Kirche oder einzelnen Adligen Hufen vom
Landesfürsten geschenkt wurden und die Kirche und die
Adligen diese etwas abseits liegenden Ländereien nicht
selbst bewirtschafteten, sondern sie an Pachtbauern abgaben.
Wann diese Art der "Pachtbauerei" zu Leibeigenschaft wurde,
ist nicht genau festzustellen, wurde jedoch im Segeberger
Gebiet erst spät eingeführt. Trotz aller "Gutuntergehörigkeit" werden die Dörfer Schlamersdorf, Berlin und Sehkamp immer wieder als "freie" Dörfer bezeichnet. Wer von den Hufnern, Kätnern, Insten und Handwerkern letztendlich leibeigen und wer frei war ist nicht genau zu ergründen. Auch war ein Wechsel durch Heirat oder freiwillige Entscheidung nicht abwägig. Viele Freie begaben sich nach der Heirat in die Leibeigenschaft zu dem Herrn ihres Partners oder aber es begaben sich Freie in Leibeigenschaft, da die Gutsherren verpflichtet waren, für ihre Leibeigenen in Tagen des Alters oder der Krankheit zu sorgen. Unter dem Einfluß der französischen Revolution wurde durch Königliche Verordnung vom 19.12.1804 mit Wirkung vom 1. Januar 1805 in ganz Schleswig- Holstein die Leibeigenschaft ausnahmslos und endgültig abgeschafft. Die Aufhebung der Leibeigenschaft und die Verpachtung der
Hufen (an die bisherigen Hauswirte) fiel in eine
wirtschaftlich höchst ungünstige Zeit. Das Jahr
1806 brachte ein völlige Mißernte und mit dem
folgenden Jahr begann Dänemark eine längere
Kriegszeit, die dem Volk, besonders der Landbevölkerung
große Lasten und Lieferungen auferlegte. In
Schlamersdorf gingen 3 Halbhufen ein, in Nachbarorten war es
schlimmer. Durch die Aufhebung der Leibeigenschaft fiel den
Einwohnern der Orte die Sorge und Verantwortung für ihr
leibliches Wohlergehen jetzt alleine zu. Dieser
Verantwortung waren viele nicht gewachsen, da Probleme
bisher vom Gutsherren gelöst wurden. |
|
Als Quellen für die folgenden Aufstellungen der Höfe bzw. die Zusammenstellung der Namen dienten : |
Die Vorfahren "meiner Hartzfamilie" kommen wesentlich aus
Schlamersdorf .
|
Bei Beginn der Aufzeichnungen sind die Hufen 2, 5 und 6 sehr eng mit dem Namen Hartz verbunden : Die Hartz - Nachfahren von der Vollhufe 2 in Schlamersdorf Die Hartz - Nachfahren von der Vollhufe 5 in Schlamersdorf Die Hartz - Nachfahren von der Vollhufe 6 in Schlamersdorf |
|
Eine Sammlung der im Kirchspiel Oldesloe
und Umgebung geborenen und / oder beheimateten Hartz seit
Beginn der Kirchenbücher ca. 1642 bis ca. 1900 findet
sich in der |
|
|
|
Schlamersdorff
: |
Schlamerstörpfer : |
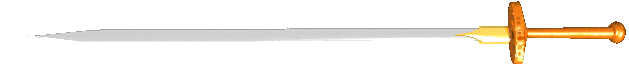
|
|
|
|
|
|
|
Heinrich Schmidt
heinrichschmidt@
onlinehome.de
